Einheitliche Regeln für Europas digitale Infrastruktur: Warum wir in der EU jetzt handeln müssen
Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einem neuen Gesetz für die Entwicklung von Cloud- und KI-Infrastruktur in Europa. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und Nachhaltigkeit der EU im Bereich digitaler Rechenkapazitäten zu stärken – und den wachsenden Anforderungen durch KI und datenintensive Anwendungen gerecht zu werden.
Alle Infos hier: KI-Kontinent – neuer Rechtsakt über Cloud- und KI-Entwicklung
Ein zentraler Aspekt dieser Initiative: die heute stark fragmentierte Landschaft nationaler Regelungen zu vereinheitlichen. Unterschiedliche Standards und Genehmigungsprozesse bremsen nicht nur Innovationen, sondern erschweren auch Investitionen und den Aufbau dringend benötigter Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten.
Die Stadt Wien misst diesem Thema eine hohe Bedeutung bei, wie Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak hervorhebt: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Weichen für ein digitales Europa zu stellen, das sowohl technologisch souverän als auch wirtschaftlich stark und sozial ausgewogen agiert. Wien engagiert sich aktiv, weil digitale Souveränität, Resilienz und Innovationsfähigkeit für uns von zentraler Bedeutung sind. Unser Ziel ist es, optimale Rahmenbedingungen zur Förderung von Innovation und Sicherheit zu schaffen.“
Aus diesem Grund hat die Stadt eine Stellungnahme abgegeben, um Erfahrungen aus der kommunalen Praxis in die europäische Gesetzgebung einzubringen und konstruktive Impulse für eine ausgewogene sowie praktikable Regelung zu geben.
Feedback from: Federal Province of Vienna / Bundesland Wien
Stellungnahme der Stadt Wien zusammengefasst
Die Stadt Wien macht sich in ihrer Stellungnahme für ein strenges, aber praxisnahes Regelwerk stark, das die derzeitige Zersplitterung nationaler Prüfverfahren ersetzt. Der Kern in fünf Punkten:
- Patchwork beenden, Tempo gewinnen
Heute muss jeder Cloud-Anbieter dieselben Audits x-fach für verschiedene Behörden und Firmen wiederholen. Das kostet Geld, bremst Projekte und bietet Bürger:innen keinen Mehrwert. Ein EU-weit harmonisierter Rahmen würde diese Bremse lösen und überall die gleichen Schutzstandards garantieren. - Eine EU-Cloud-Zertifizierungsbehörde
Wien plädiert für ein einziges EU-Siegel, das zentrale Aspekte von DSGVO (Datenschutz) und NIS2 (Cybersicherheit) bündelt. „Certified once, accepted everywhere“: Wer das Label trägt, soll europaweit ohne Zusatzprüfungen in Vergabeverfahren antreten können – ein Vorteil für öffentliche Hand und Privatwirtschaft. - Digitale Souveränität absichern
Die zentrale Stelle könnte:- strikter über DSGVO-Kernfragen wie Datenexporte in Drittländer wachen und
- technische + rechtliche Vorkehrungen verlangen, die unbefugten Zugriff durch Nicht-EU-Staaten verhindern (z. B. Pflicht zu Security-Updates, Entflechtung proprietärer Software).
- Vorbild FedRAMP & DoD
Die USA zeigen mit FedRAMP und den darauf aufbauenden DoD-Standards, dass eine zivile Basiskontrolle plus branchenspezifische Zusatzauflagen Geld spart und selbst Hochsicherheits-Workloads abdeckt. Die EU kann dieses Zwei-Ebenen-Modell übernehmen.
Fazit
Ein einziges EU-Zertifikat mit echten Souveränitätsklauseln reduziert Bürokratie, erhöht die Sicherheit und stärkt Europas strategische Autonomie. Wien ist bereit, diesen Weg gemeinsam mit den EU-Institutionen zu gehen – ohne Schnörkel, aber mit klaren Zielen.


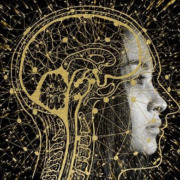 pixabay.com/geralt/Gert Altmann
pixabay.com/geralt/Gert Altmann Frederic FEUTRY
Frederic FEUTRY Freepik/Vecstock
Freepik/Vecstock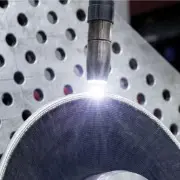 LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH
LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH Cities Coalition for Digital Rights - Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Cities Coalition for Digital Rights - Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Anna Kuprian
Anna Kuprian Stadt Wien
Stadt Wien